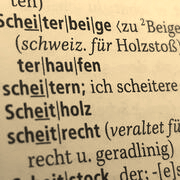|
Scheitern
«Im Kreuz Christi finden wir das Heil»*Die christliche Glaubenspraxis vermittelt alternative Leitbilder gelingenden Lebens zu den gängigen Erfolgsgeschichten. Die Feier des Pascha-Mysteriums lädt dazu ein, das Scheitern als Momentum der Gnade zu sehen. Wer sich als gescheitert empfindet, lässt sich mit dem Spruch «Nobody is perfect» nicht trösten. Das Scheitern erscheint als etwas definitiv Tragisches. Dabei kann die Erfahrung des Scheiterns auf sehr unterschiedlichen Ebenen liegen. Seine Bezugsgrösse kann ein Projekt, eine berufliche Karriere oder Lebensperspektive sein. Sie kann aber auch in einer zwischenmenschlichen Beziehung liegen oder in jener mit Gott. Insofern es sich um einen bestimmten, durch eine Kultur geprägten Lebensentwurf handelt, reicht die schmerzliche Betroffenheit in eine grössere Gruppe hinein. Der Umgang damit bleibt immer schwierig. Scheitern ist mit Scham behaftet, wenngleich nicht zwingend moralische Verantwortung mit im Spiel ist. In jedem Fall wird die subjektive Erfahrung des Scheiterns unterschiedlich einschneidend erfahren. Dies ist sicher mit ein Grund, weshalb der herkömmliche Umgang mit dem Thema Scheitern den betroffenen Personen individuell überlassen ist – auch unter Christen. Christlicher Perspektivenwechsel: Erfolg ist keiner der Namen Gottes (M. Buber)Der Blick auf Jesus zeigt indes, dass dieser in seiner öffentlichen Wirkungszeit den Gescheiterten in besonderer Weise nahe war. Ja, er selbst ist gewissermassen ein Gescheiterter. Nach bloss drei Jahren kam sein Gut-Sein durch Verrat, Verleumdung, Anklage, Folter und Tod zu einem jähen Ende. Der niederträchtige Hinrichtungsgalgen ist für die unter Schock stehende Jesusbewegung zuerst Zeichen der Schande und des Scheiterns. Durch die Ostererfahrung lernen sie, dasselbe Bild, das Kreuz, mehr und mehr als Zeichen des Sieges zu verstehen. Gescheitert ist Jesus bezüglich einer ganz bestimmten messianischen Erwartung. Im Rückblick ist er nicht so sehr als der Löwe Judas zu deuten, der das Volk mit starker Hand von den Römern befreien würde. Sein Sieg, so verstanden sie nach und nach, liegt viel umfassender in der Öffnung der Tore des Paradises für alle Menschen guten Willens: durch den Weg ganz nach unten. Der wahre Christus ist das geopferte Lamm. In jedem Gottesdienst das ganze Heilsgeheimnis: OsternIm Osterereignis erkennen wir das soteriologische Datum schlechthin. Deshalb feiern wir in jedem christlichen Gottesdienst dieses Bekenntnis zu Ostern und dies als erlöste Menschen. In der Eucharistie freilich wird dieses Pascha-Mysterium explizit rituell vollzogen. In der Gedächtnishandlung des letzten Abendmahls Jesu mit seinen Jüngern wird in jeder Messe deutlich, dass Jesus sein «Scheitern» als Ganzhingabe für alle Menschen deutete. Er empfahl die Anliegen der ganzen Welt mit am Kreuz ausgebreiteten Händen dem barmherzigen Vater an (vgl. Joh 12,32). Wenn es so etwas wie einen liebenden Gott gibt, kann er den ermordeten Gerechten nicht im Tod belassen. Er wird die Bitte seines geliebten Sohnes, die er im Moment seines Opfertodes an ihn richtet, erhören. Anders kann ein liebender Gott nicht gedacht werden. Grossmütiger Grundgestus der liturgischen RitenUnsere mit Scham behafteten Erfahrungen des Scheiterns werden in der Liturgie kaum direkt angesprochen. Und doch sind sie dort gut aufgehoben. Die oben skizzierte österliche Kreuzestheologie wirkt, bald explizit, bald unterschwellig diskret, in allen gottesdienstlichen Vollzügen. Immer wieder werden Zeichen ausgesandt, die als Einladung verstanden werden können, seine eigene Erfahrung des Scheiterns diskret einzubringen. Es gehört zur Stärke eingeübter ritueller Vollzüge, dass ihr differenziertes Sinnrepertoire nach und nach in tiefere Schichten des Verstandes dringen und entsprechend abgerufen werden kann. Das kann immer mal wieder der Bussakt zu Beginn eines Gottesdienstes sein. Aber es gibt auch unerwartete Situationen, etwa ausgelöst durch einen Gesang. Oder das Tagesgebet der Palmsonntagsmesse holt mich ab, als wäre es für mich geschrieben: «[...] Deinem Willen gehorsam, hat unser Erlöser Fleisch angenommen, er hat sich unter die Schmach des Kreuzes gebeugt. Hilf uns, dass wir ihm auf dem Weg des Leidens nachfolgen und an seiner Auferstehung Anteil erlangen [...].» Oder der tausendmal geübte Psalm 130 (De Profundis) berührt mich plötzlich, weil genau jetzt ich der bin, der aus der Tiefe irgendwo hin rufen will und nicht ein noch aus weiss. Schlichte Formen der VolksfrömmigkeitWir haben alle gelernt, dass die Passionsfrömmigkeit typisch sei fürs Spätmittelalter und also besser auf eine Osterspiritualität hin zu überwinden sei. Aber Ostern setzt Passion und Kreuz voraus. Da keiner das Herz einer anderen kennt, können wir nur ahnen, inwieweit überkommene, aber beliebte Formen der Volksfrömmigkeit nicht zu unterschätzende diskrete Zufluchtsorte sind, an denen der eine oder die andere ihr Scheitern anonym in die Passion Jesu hineinlegt. Wenn sich in dem seit über 400 Jahren weltweit beliebten Kreuzweg hartnäckig gehalten hat, dass Jesus dreimal unter der Last des Kreuzes gefallen sei, dann doch wohl deshalb, weil man eben das Scheitern nicht verdrängen soll. Einmal ist keinmal. Ein zweites Mal geht eventuell als ein peinlicher Misstritt durch. Aber dreimal fallen kann ich nicht mehr weglächeln. Und wenn dann auch noch irgendein zufällig zur falschen Zeit am falschen Ort rumstehender Typ geheissen wird, tragen zu helfen, tut sich ein weites Feld an Identifikationskonstellationen für uns heutige Kinder einer arbeitsteiligen, professionellen Leistungsgesellschaft auf. Sich eingestehen müssen, dass man auf Hilfe angewiesen ist, gehört für viele in die Kategorie Scheitern. Fehlt nicht doch etwas?Ich habe bis hierhin zu verstehen versucht, weshalb die herkömmliche rituelle Glaubenspraxis in Gottesdienst und Volksfrömmigkeitsformen das Scheitern einerseits nicht beim Namen nennt und andererseits die vorhandenen Andockstellen unterschwellig omnipräsent sind (Kreuzestheologie; Pascha-Mysterium). Sie deutet sie sehr indirekt an und spricht das Individuum in seinem inneren, persönlichen Unterscheidungsweg an. Ich glaube tatsächlich, dass darin eine grosse Weisheit liegt: Das Empfinden einer Situation des Scheiterns ist in jedem Fall unterschiedlich, und es ist – wenngleich zwei oder mehrere Personen davon betroffen sind – von der je einzelnen Person zu bewältigen. Insofern ist das Thema im pastoralen Kontext neben den angedeuteten diskreten rituellen Hilfen im persönlichen Seelsorgegespräch und in der geistlichen Begleitung richtig aufgehoben. Peter Spichtig |