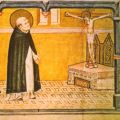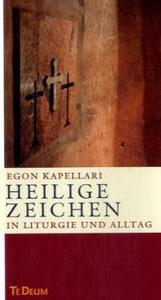Ins Leben eintauchen - Knien als LebenshaltungEs ist ein Unterschied, ob jemand zur Gartenarbeit oder zum Gebet kniet. Die Differenz liegt in der inneren Haltung des Tuns. Muss man heute noch Knien? Diese gänzlich unbequeme Körperhaltung ist doch mehr ein Relikt aus vergangenen Tagen! Sieht man heute einen Menschen knien, so denkt man meist an eine veraltete Gebetshaltung oder eine übermässige Unterwürfigkeit. Doch diese Zeiten sind ja längst vorbei, heute hat es niemand mehr nötig, vor etwas zu knien. Der Mensch hat sich die Welt selbst zu Füssen gelegt und lässt sie nun vor sich knien. Die Aufklärung, eine weitreichende Säkularisierung Europas und wirtschaftlicher Erfolg scheinen die Positionen vertauscht zu haben. Der Mensch ist sein eigener Herr geworden. Er nimmt sein Leben selbst in die Hand und formt sie nach seinem eigenen Plan.Doch diese Sicht der Dinge wird nur oberflächlich Bestand haben. Trotz eines forcierten Individualismus, dem Absolut-Setzen der Verstandestätigkeit und dem Erfolg der Naturwissenschaften weiss sich jeder Mensch in seinem Leben von Scheitern und Nicht-Können umfangen. Meist ist hier nicht einmal der Endpunkt gesetzt. Oft scheitert der Mensch nicht nur aufgrund seiner eigenen Bedingungen, sondern wird von anderen „in die Knie gezwungen" – vom Chef, der Firma, der Bankenkrise, von Betrügern, dem Partner, usw. Der Mensch wird damit zum Ausdruck des Scheiterns anderer. Den Höhepunkt des Scheiterns erreicht der Mensch schliesslich in seinem Tod. Diese Hürde vermag er nicht zu nehmen. Oder doch? Knien als Weg zum LebenOb Leben scheitert oder gelingt wird immer darauf ankommen, wie der Mensch sein eigenes Leben gestaltet. Glücken wird es, wenn er sich eingesteht, ein Kniender zu sein. Einer, der sein Leben gerade nicht selbst in der Hand hat, nicht alles kann und alles beherrscht. Der darum weiss, dass sein Leben von etwas grösserem herkommt. Wird er sich dessen bewusst, so wird er durch alles Scheitern hindurch über das Scheitern erhaben werden. Im Knien gesteht sich der Mensch ein, dass es Dinge im Leben gibt, die ihn übersteigen. Im Alltag sind dies oft Banalitäten, wo der Mitmensch etwas besser kann als ich. Diese Erfahrung steigert sich jedoch bis ins Existenzielle, dem Punkt des Sterbens. Spätestens hier geht jeder Mensch in die Knie und findet sich vor Gott, dem Grösseren, wieder. Erkennt sich der Mensch als einer, der mit seinem ganzen Leben vor Gott kniet, so ermöglicht ihm das jene Freiheit, nicht alle Last des Lebens selbst tragen zu müssen. Er muss nicht mehr vor all seinem Unvermögen fliehen und perfekt sein, damit sein Leben gelingt. Bewältigen muss er nur, was er auch bewältigen kann. Alles andere darf er getrost Gott überlassen. Der Mensch macht sich damit klein und zeigt Schwäche, aber genau diese Schwäche führt ihn in ein glückendes Leben hinein. Er kann sich von Gott, dem Grösseren, aufnehmen lassen und taucht damit in jene Auferstehungsbewegung ein, die den Tod nicht kennt. Jesus kniet mit den MenschenDen Mut, sich vor Gott klein zu machen und vor ihm die Knie zu beugen, hat Jesus Christus den Menschen vorgelebt. In seinem Beispiel hat er gezeigt, dass Christsein nicht im Knien endet, sondern in einer Existenz des Stehens, der Auferstehung, gipfelt. Auf dem Leidensweg seiner letzten Tage hätte Jesus sein Schicksal des Kreuzes gerne an sich vorüber gehen lassen, doch er hat sich seinen Richtern gestellt. Aus Liebe zu den Menschen hat er den ihm gereichten „Kelch" angenommen und sich im knienden Gebet ganz dem Vater übereignet: „Nicht mein, sondern dein Wille soll geschehen" (Lukas 22,42) hat er dem Vater zugerufen. Er hat seinen Willen aufgehoben und in die Hand des Vaters gelegt. Er hat ihm sein unmissverständliches Vertrauen entgegengebracht, dass Gott ihn selbst und mit ihm alle Menschen zum ewigen Leben führen wird. Im Knien hat er sich klein gemacht und allen gezeigt, dass er die folgende Zeit nicht alleine meistern kann, die Situation übersteigt ihn. Indem er sich jedoch mit seinem Willen ganz dem Vater anheim gibt, befreit er sich vom menschlichen Drang, das eigene Leben retten zu müssen. Gerade dadurch erlangt er die Kraft, das Kommende durchzustehen. Er hat sich aber auch von denen befreit, die ihm nach dem Leben trachteten. Sie konnten seinen Willen durch seinen Tod nicht mehr brechen. In seinem schändlichen Tod ist er schliesslich bis in die letzten Winkel der menschlichen Existenz mit all ihrem Scheitern und Versagen hinabgestiegen. Er hat sich mit den Menschen in ihren Alltag hineingekniet, jenem Alltag, der sie sooft überfordert und scheitern lässt, um von dort aus, alle Menschen aufnehmend, zu Gott aufzusteigen und in eine stehende Existenz hineinzuführen. Wer kniet, wird am Ende stehen!Überwindet der Mensch seinem Egozentrismus und erkennt Gott als seinen Schöpfer, so kann er getrost vor ihm in die Knie gehen. Er überwindet seinen Willen und legt diesen vertrauensvoll in die Hand Gottes. Dieser Akt befreit ihn von allem menschlichen Erfolgsdruck, denn er weiss sich schon von vornherein in Gott geborgen. Er tritt damit in jene Bewegung ein, die allen Menschen durch Jesus Christus verheissen ist. Eine Bewegung, die vom „Noch-Nicht" zum Ziel führt. Vom Knien zum Stehen. Vom irdischen zum göttlichen Dasein. Im Knien erfährt der Mensch die Vorfreude, einst von Gott emporgehoben zu werden, um in Gottes Herrlichkeit und in die Vollendung des menschlichen Daseins einzutauchen. Er beginnt jenen Weg, der sich am Ende seines Lebens zu einem geheilten und ewigen Leben bei Gott weitet. Knien beim GebetAls Ausdruck dessen, dass der Mensch seinen Schmerz des Lebens nicht alleine tragen muss, macht sich der Beter klein und kniet sich nieder. Damit tritt er immer wieder aufs Neue in die Auferstehungsbewegung Jesu hinein und schöpft daraus die Kraft, seine eigenen Schwächen und Fehler einzugestehen. Er kann seine Existenz mit all ihrem Glücken, aber auch Scheitern, annehmen und vermag zu sprechen: Gott, sieh her. Ich bin gebeugt und knie vor Dir, denn ich vermag die Last des Lebens nicht zu tragen. Du bist mein Schöpfer, grösser und stärker als ich. Hilf Du mir, ich bitte dich, meine Lasten zu tragen. Der Beter bringt damit zum Ausdruck, dass er dem Leben alleine nicht gewachsen ist. Er nicht Herr über alles ist. Er braucht die Zuwendung Gottes, um sein Leben bestehen zu können. Er ruft ihn daher im Gebet an und bittet ihn um seinen Bei-stand. In schweren Stunden wird er vor Gott klagen, noch viel mehr wird er ihn jedoch als seinen guten Vater erkennen und ihn für seine Schöpfung preisen. Knien als Zeichen der VerehrungEine besondere Stellung hat das Knien in der Liturgie als Zeichen besonderer Ehr-furcht und der Anbetung: während des Hochgebets, der eucharistischen Anbetung oder auch beim sakramentalen Segen. Hier rückt vor allem der Lobpreis Gottes in den Vordergrund. Die Menschen erkennen Gott als ihren Herrn und verehren ihn für seine guten Taten, welche er den Menschen in seiner Schöpfung entgegenbringt. Immer schwingt aber auch die Bitte mit, dass Gott die Menschen zu Teilhabern seiner Herrlichkeit machen möge. Es gibt verschiedene Arten des Kniens. Die bekannteste Form ist wohl das Beugen der Knie in einem Ausfallschritt. Am häufigsten vollzieht diese Kniebeuge der Kirchenbesucher, wenn er ein Gotteshaus betritt und sich dem Tabernakel, dem Ort der Aufbewahrung des Leibes Christi, nähert. Er begrüsst damit Gott als seinen Herrn und bringt ihm seine Ehrfurcht entgegen. Dahingegen gibt es das Knien als Haltung, indem man auf dem Boden oder einer Kniebank mit beiden Beinen kniet. Dies ist eine ausdrückliche Gebetshaltung und wird vor allem zum persönlichen Gebet eingenommen. Ebenso in sakramentalen Vollzügen, wo an eine besondere Nähe Gottes geglaubt wird. Knien ist nicht gleich KnienEs ist ein Unterschied, ob der Mensch zur Gartenarbeit oder zum Gebet kniet. Die Differenz liegt dabei in der inneren Haltung des Tuns. Während das Knien zur Gartenarbeit keine innere Haltung voraussetzt sondern allein der Arbeitserleichterung dient, ist dies beim Gebet anders. Hier ist das Knien ein sekundäres Element einer primären, inneren Haltung. Doch oft läuft der Mensch Gefahr, in aller menschlichen Hast und Unruhe, die Gebetshaltung des Kniens nicht mehr von der Haltung bei der Gartenarbeit zu unterscheiden. Damit das liturgische Knien nicht zur Oberflächlichkeit verkommt, hat Romano Guardini die innere Haltung des Kniens treffend so formuliert: „Wenn Du die Knie beugst, lass es kein hastig-leeres Geschäft sein. Gib ihm eine Seele. Die Seele des Kniens aber ist, dass auch drinnen das Herz sich in Ehrfurcht vor Gott neige; in jener Ehrfurcht, die nur Gott erwiesen werden kann: dass es anbete ... Mein grosser Gott!"
Thomas Kohler
|
Stichwort
Geistlicher Impuls"Am Herrentag beten wir stehend, indem wir dadurch das Feststehen des kommenden Äons ausdrücken. An den anderen Tagen beugen wir die Knie, indem wir dadurch den Fall des Menschengeschlechts unter die Sünde andeuten. Indem wir uns von der Kniebeuge erheben, machen wir ja die uns allen durch Christus geschenke Auferstehung deutlich, die am Herrentag gefeiert wird." Neilos von Ankyra, geboren Ende des 4. Jahrhunderts, Brief an Ursacius, in PG 79, 444 (Nilus, Ep. III, 132) FactsZum Knien beim Hochgebet der Messe:"Wenn die Platzverhältnisse oder eine große Teilnehmerzahl oder andere vernünftige Gründe nicht daran hindern, soll man zur Konsekration knien." Allgemeine Einführung in das Römische Messbuch (1975) Nr. 21 Lesetipp
Egon Kapellari: Heilige Zeichen in Liturgie und Alltag. Te Deum - Jahresedition 2009. Verlag Kath. Bibelwerk. ISBN 978-3-460-23201-3 Text-Beispiel: "Eure Knie sind eure Flügel ..." (G. von Le Fort) |